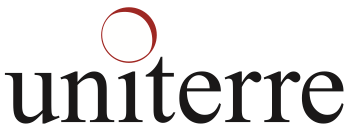Seit Jahren setzt sich Uniterre für faire, kostendeckende Produzent*innenpreise ein. Mit 69.25 Rp./kg lag der durchschnittliche Milchpreis 2022 (gemäss Jahresbericht von Swissmilk) weit unter den Produktionskosten. Unter dem gewaltigen Preisdruck der Verarbeiter und Grossverteiler werfen immer mehr Milchproduzent*innen das Handtuch. 1998 zählte die Schweiz noch rund 44’000 Milchbetriebe, Ende 2022 waren es 17’603!
Im September 2019 haben wir die Faire Milch „Faireswiss“ lanciert. Unsere langjährige Forderung nach 1 Franken pro Kilo Milch konnte damit für die beteiligten Betriebe erfüllt werden, was mehr als einen Hoffnungsschimmer darstellt. Die Faire Milch „Faireswiss“ ist nunmehr eine von Uniterre unabhängige Genossenschaft und hat sich erfolgreich etabliert.
Eine gute Handvoll von Milchproduzentinnen und -produzenten bearbeitet in der Arbeitsgruppe Milch nebst der Tagesaktualität vor allem folgende Themenkreise:
• Die Verkäsungszulage, welche nur zum Teil den Weg bis zu den Produzentinnen und Produzenten findet.
• Der Standard-Milchlieferungsvertrag der Branchenorganisation Milch (BO Milch), welcher sich nicht an die Vorgaben der Eidgenössischen Räte halt.
• Die Butterimporte und der gleichzeitige Export von Industriekäse zu Dumpingpreisen, welcher unsere qualitativ hochstehenden Käseexporte sabotiert.
Wir pflegen enge Kontakte mit der „Bäuerlichen Interessengemeinschaft Milch“ Big-M vom Säuliamt. Auf europäischer Ebene sind wir Mitglied beim „European Milk Board“ EMB.
E inheimisches Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen sind Grundpfeiler unserer Autonomie und Ernährungssicherheit. Extremwetterereignisse nehmen drastisch zu und belasten die Sicherheit und die Qualität der Erträge. Für die landwirtschaftlichen Betriebe bedeutet dies, dass sie die Risiken besser erkennen und ihnen vorbeugen müssen. Offene Landflächen, insbesondere Fruchtfolgeflächen, müssen geschützt werden. Bodenqualität und Biodiversität müssen beim Schutz von Agrarland besser berücksichtigt werden.
Uniterre fordert eine transparente Herkunftsdeklaration, die Regulierung der Importe, insbesondere der 120’000 Tonnen vorgefertigter industrieller Backwaren, und faire Preise. Ökologische Produktionsmethoden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Uniterre hat eine Arbeitsgruppe Ackerbau.
Angesichts der Herausforderungen für Umwelt und Klima stehen wir einen vernünftigen Fleischkonsum ein, bei dem Qualität vor Quantität geht. Dennoch muss der Wert der Weidewirtschaft für die Erhaltung der Biodiversität, die Aufwertung der Grasflächen in den Bergregionen und den Schutz vor Naturgefahren anerkannt werden. Im Sinne einer diversifizierten und autonomen bäuerlichen Landwirtschaft hat die Viehzucht ihren Platz, auch im Flachland. Uniterre setzt sich für eine bäuerliche Tierhaltung ein, in der das Wohl der Tiere und der Schutz unserer Ressourcen gewährleistet sind. Dies ist nur mit fairen und gerechten Strukturen für uns Bäuerinnen und Bauern möglich.
Es braucht kostendeckende Preise für die Produzent*nnen und Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das bäuerliche Einkommen muss garantiert werden, insbesondere um den Selbstversorgungsgrad, der für die Ernährung unserer Tiere notwendig ist, aufrechtzuerhalten oder sogar zu erhöhen. Auch bei Importen müssen die Schweizer Standards angewandt werden.
Uniterres Fleischkommission ist eine Gruppe, die auf diese Fragen spezialisiert ist. Sie besteht aus einem Mitglied des Sekretariats sowie Landwirt*innen aus den verschiedenen Sektionen. Sie nimmt Stellung zu aktuellen Fragen der Agrarpolitik, formuliert Forderungen und setzt sich dafür ein, dass die Produktion und der Konsum von Fleisch im Einklang mit wirtschaftlichen, ethischen, sozialen und ökologischen Anforderungen stehen.
Im Bereich des Weinbaus arbeiten wir insbesondere an den Fragen rund um Marktzugang, Konkurrenz und Importe. Während der inländische Weinkonsum seit Jahren kontinuierlich zurückgeht, bleiben die Importkontingente unverändert hoch und bedrängen zunehmend die einheimische Produktion.
Wie für alle anderen Branchen auch setzt Uniterre auf eine lokale und nachhaltige Produktion. Im Einklang mit dem erforderlichen Produktionsaufwand sollen die Produzentenpreise sowohl für die familieneigenen als auch für die familienfremden Arbeitskräften (oftmals ausländische Hilfskräfte) würdige Arbeitsbedingungen und eine korrekte Entlöhnung gewährleisten.
Das Obst und Gemüse, das in der Schweiz verzehrt wird, belegt die ersten Regale am Eingang der Supermärkte und trägt wesentlich zum Image einer humanen, produktiven und respektvollen Landwirtschaft bei, das von den Kommunikationsabteilungen des hiesigen Agrobusiness vermarktet wird.
Die beiden orangen Riesen und die Discounter sind sich nicht zu schade, von der «Unterstützung» zu profitieren, die die Bevölkerung «ihren Gemüsebauern und -bäuerinnen» zukommen lassen möchte. Und je lokaler, saisonaler und biologischer das Obst oder Gemüse angebaut wurde, desto teurer wird es an diesen einladenden Ständen. Wie eine Studie der des Westschweizer Konsumentenschutzes (FRC) ergab, lässt sich dies gut durch die Gewinnmargen der Supermarktketten erklären. Das Zwei-Phasen-System, das die Schweizer Obst- und Gemüseproduktion durch eine Zollschranke während der hiesigen Erntesaison schützen soll, setzt den Sektor in Wirklichkeit stark unter Druck. Ausserhalb der Saison sind die Preise niedrig, da die Supermärkte von Importen zu Spottpreisen profitieren, während in der Saison der einheimischen Produktion die Preise in den Geschäften am höchsten sind, da die Supermärkte davon profitieren, um ihre Gewinne zu erhöhen.
Ausserdem deutet die Zunahme von «Club»-Sorten im Obstbau (Auflagen für Anbauflächen und technische Routen, Käufer, Preise und Verkaufskriterien) auf eine immer engere Angleichung an die europäischen Auflagen hin, was ein schwindendes Angebot an freien und bäuerlichen Sorten ergibt zugunsten von F1-Hybriden, und künftig vielleicht auch von biotechnologischen Basteleien. Die Branche muss sich also neu erfinden, wenn sie nicht zum Wasserträger der Agrarindustrie verkommen will. In diesem Sinne unterstützt Uniterre die Diversifizierung der Strukturen, bäuerliches Saatgut und frei zugängliche, an die lokalen Bedingungen angepasste Sorten, sowie Initiativen, die kurze Transportwege ermöglichen. Wir positionieren uns auch für gerechte soziale Bedingungen, insbesondere in diesem Sektor, der am meisten Arbeitskräfte, vor allem Saisonarbeiter, benötigt.